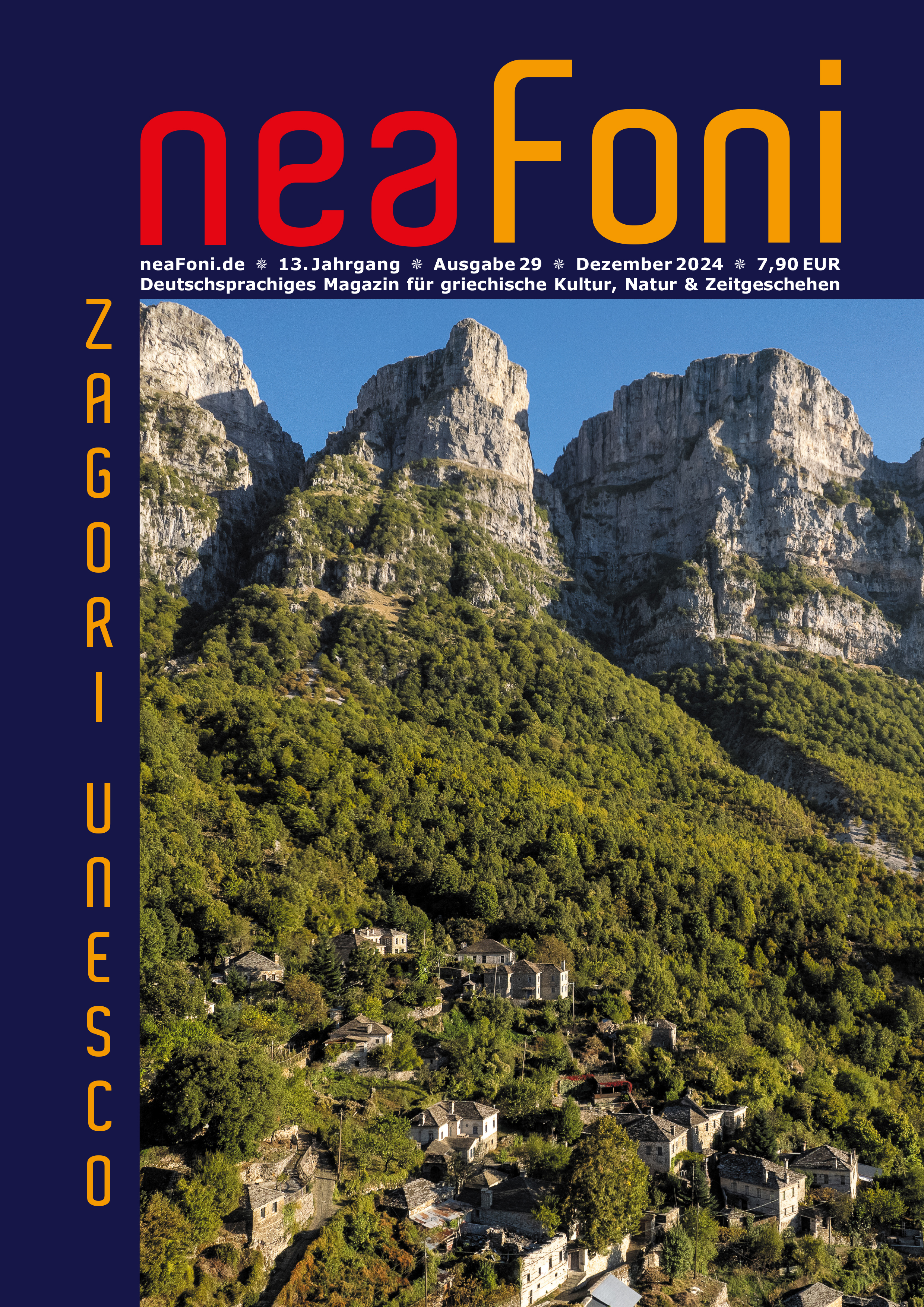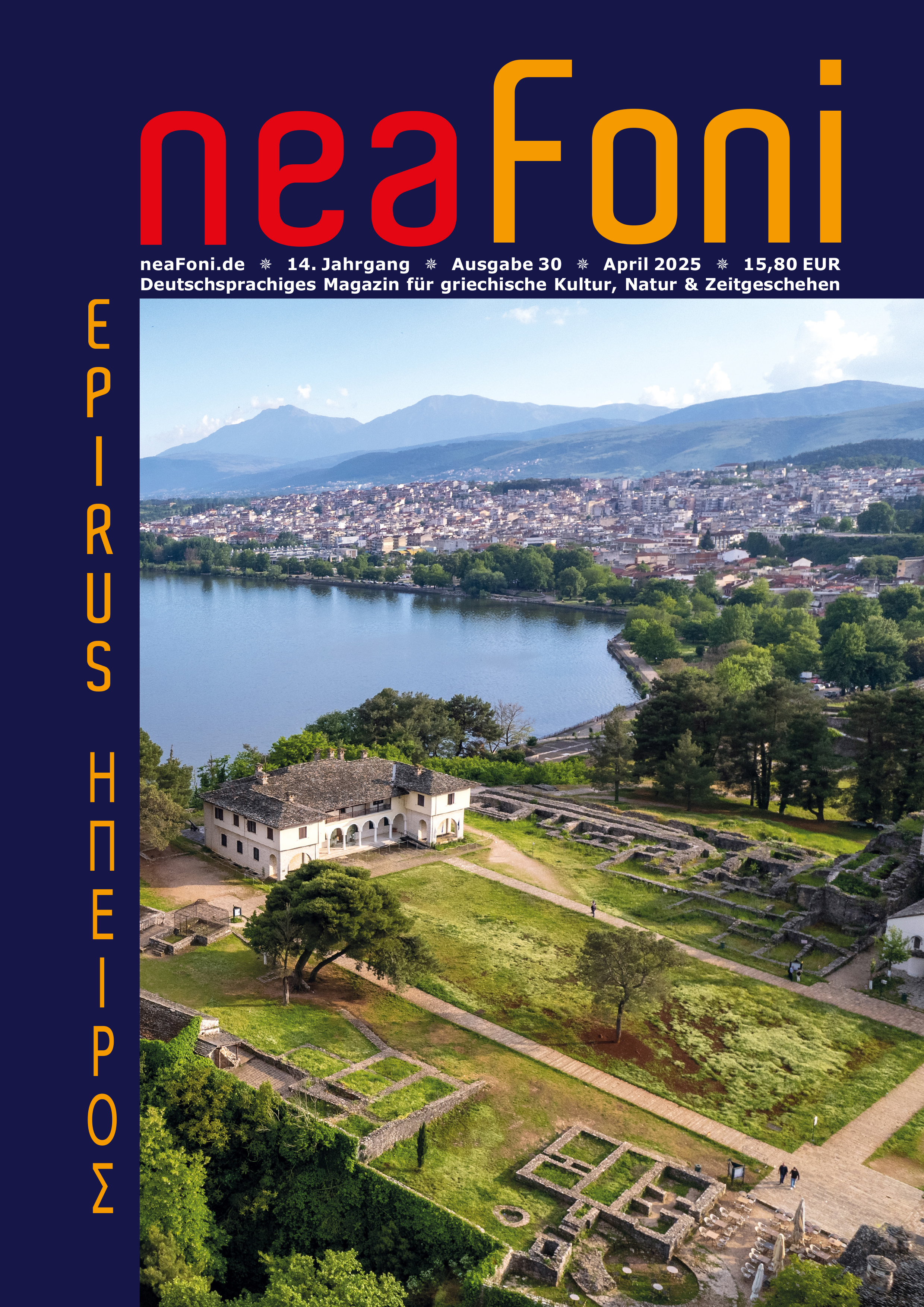Da betiteln zwei Griechinnen ihre Auswahl zeitgenössischer Erzählungen aus Griechenland „Die Erben des Odysseus“. Odysseus-Ableger heute, das sind leider keine mythologischen Gestalten, die hölzerne Pferdchen vor die Mauern stellen, um in feindliche Metropolen reinzuplatzen, nein, das sind sehr reale Monster, die ungebremst vom Himmel herunter gefetzt kommen. So brav, wie Homer seine Trojahelden losschickte, läuft’s auf dem Planeten leider nicht mehr. Die Szene hat sich entschieden zum Obszönen gewendet. Was Wunder also, dass die hier versammelten Ururenkel/innen des greisen blinden Sängers ihrerseits von Aggressivität, Verzweiflung, Verunsicherung, Vereinsamung zu sagen haben.
Christophoros Milionis (Jg. 1932) beschreibt, wie in noch immer funktionierenden arkadischen Gefilden ein Dreckskerl von Ziegenhirt einer unberührten Maid nachstellt, indem er deren Zicklein „bei den Hörnern packt, mit ihrem Kopf zwischen seinen Schenkeln, und seinen Bock, aufgegeilt wie er war, sich auf sie stürzen lässt, die Zunge herausgehängt.“ Etwas dezenter geht’s (durch seinen Bestseller Ihr rotgefärbtes Haar bereits bestens bekannt) bei Kostas Murselas (Jg. 1931) zur Sache. Da sucht in Athens Nobelgegend einer mit Sehbeschwerden einen Augenarzt auf und wird, seltsam, seltsam, in dessen Salon zu Kaffee und Klavierspiel gebeten. „Nicht von Chopin, es ist seine eigene Musik“, merkt die Dame des Hauses an, die - außer dass sie Jasmin- und Lavendelduft verströmt - sich allmählich entblättert. „Im Halbdunkel konnte man die Konturen ihres Körpers gerade noch erahnen“, lautet das Resultat der etwas schwülen Sehschärfenbestimmung. Bei Alki Zeï (Jg. 1925) heißt die Story nicht Grieche liebt Deutsche, sondern umgekehrt, und zwischen beiden klappt alles wunderbar. „Sie hatten keine Kinder, aber als das Internet kam, war ihr Glück vollkommen.“ Doch siehe da, er chattet und chattet, verknallt sich in eine Polin, und - c’est la vie - aus ist’s mit der Glückherrlichkeit. Auf etwas humorigere Weise kippt die Situation von gemütlich zu letal bei Elias Papadimitrakopulakis (Jg. 1930). Kein Grieche, der nicht Fan seiner gewissermaßen aus Alexander d. Gr. Zeiten stammenden Eisenbahn ist, und die Fahrt mit ihr – ein reiner Spaß: „Das Meer lag etwa dreizehn Kilometer entfernt. Der Zug fuhr durch Weinberge, Landgüter, Klosterbesitztümer und Sanddünen. Bei den Bahnstationen stiegen die jungen Leute aus und pflückten von den nächststehenden Weinstöcken ganze Trauben schwarzer Weinbeeren.“ Ein Gaudi sondergleichen, mit dem es schlagartig Sense ist, als an der Endstation ein junger Russe gleich vom Waggon runter „mit einem spektakulären, schwungvollen Kopfsprung“ ins Wasser hechtet, wo ihn ein maroder Pfahl pfählt. Schwarzer Humor.
Die Peripetien, mit denen diese Erzählungen überraschen, befördern die Einsicht, dass es die Griechen in ihrem Land unter der Sonne auch nicht immer ganz lustig haben. Jedenfalls richtig zum Lachen - wie Homer die Götter über die beim Fremdgehen mit Ares erwischte Aphrodite lachen lässt - hab ich nichts gefunden. Wobei an Tonarten von heiter spöttisch bis melancholisch larmoyant so ziemlich alles da ist. Was bedeutet, dass man beinahe bei jedem Umblättern auf eine andere Stimmungslage umpolen darf. In Selbstquälerei artet das Ganze trotzdem nicht aus, schließlich fungiert kein Philoktet, sondern der schlaue, gewitzte, listige, tausend Abenteuern entronnene Odysseus als Frontmann. Dessen aktuelle Entartung mit herbeigeschrieben zu haben, das wäre ein übler Vorwurf. Genauso abwegig wäre aber auch die Erwartung: jeder Odysseuserbe sei ein Hans im Glück. Nikos Vassiliadis (Jg. 1942) versichert: Bei meinen Schreibversuchen „hatte ich niemals eine Botschaft zu vermitteln.“ Das gleiche, nur etwas blumiger, gibt Nikos Chuliaras (Jg. 1940) von sich: Einer, der schreibt, „ist anscheinend eine Art Schiffbrüchiger, der sehr wohl weiß, dass er niemals gerettet wird, und trotzdem nicht damit aufhört, Flaschen mit Zetteln ins Meer zu werfen und zu warten.“ Dass solche „Zettel“ merkwürdig irritieren und verstören können, erfährt man spätestens bei Dimosthenis Kurtovik (Jg. 1948), dem Star in diesem Ensemble (in dem Vassilis Vassilikos allerdings vermisst wird).
Mit dem Eingeständnis, man hänge nicht mehr - wie der/die eine oder andere früher einmal - irgendwelchen Visionen nach, geht der Hinweis konform, dass Dichtung und Wahrheit nicht im Verhältnis 1:1 zu nehmen sei. So wie Michel Fais (Jg. 1957) begriffen hat „die Wahrheit hinkt“, raten auch andere Autor(inn)en - jede der zehn Damen und jeder der zwanzig Herren stellt dem eigenen Text ein Statement voran - zur Vorsicht vor allzu bequemer Vertrauensseligkeit. Vassilis Tsiambussis (Jg. 1953) hatte zu einer Erzählung gemacht, was ihm irgendwann von irgendjemandem in irgendeinem Kafenion zugetragen worden war. Als dieser Jemand dann das fertige Buch in die Hände bekam, beklagte er sich gegenüber einem Kumpel: „Er hat die Geschichte völlig zerknittert. Nichts passierte so, wie er es beschreibt.“ Dem Verfasser hingegen bekundet er mit öligem Respekt: „Die Geschichte, so wie du sie gemacht hast, ist wahrer als die wirkliche.“ Womit sich ein weiteres mal bestätigt, was Mark Twain (Reisen ums Mittelmeer) schon immer wusste, nämlich: „Das Lügen und Betrügen fliegt den Griechen von vornherein ganz natürlich zu... Nur wenige behaupten, dass man an ihnen irgendwelche Tugenden entdecken könne.“ Von den hier versammelten Erzähler(inne)n sowie den beiden Herausgeberinnen hätte Mark Twain allerdings garantiert das glatte Gegenteil behauptet.
Niki Eideneier und Sophia Georgallidis (Hg.)
Die Erben des Odysseus.
Griechische Erzählungen der Gegenwart.
München (dtv) 2001, 263 S.